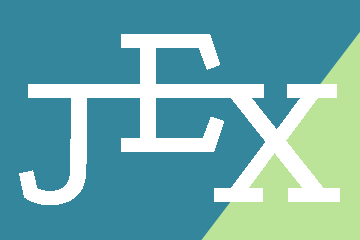Der Eintritt in die Szene
Vom Wunsch, ein Täter zu sein
Von ACD.
Es war der Abend eines WM-Spiels. Ich saß mit Freunden in einem Park zusammen. Deutschland spielte. Jemand rief: „Deutschland verrecke!”. Meine Antwort: „Deutschland erwache”. Eine Flasche flog von einer Brücke in die Nähe meiner Gruppe. Ich rannte hoch. Ein Messer befindet sich in meiner Tasche. Dort treffe ich auf einen jungen Mann mit „erkennbarem Migrations-Hintergrund“. Er ist in Feierlaune. Ich gehe auf ihn zu und stelle ihn zur Rede. Frage, was ihm einfalle, eine Flasche auf uns zu werfen. Er hat Angst vor mir. Streitet alles ab. Ich gehe wieder, sage meinen Bekannten, ich hätte den Schuldigen gefunden. Er würde es nicht mehr machen, sonst würde ich ihn die Brücke herunterwerfen. Meine Bekannten sehen mich geschockt an. Wechseln schnell das Thema. Ich fühle mich gut.
Eine andere Nacht. Es ist spät. Ich bekomme einen Anruf von einer Freundin. Sie wurde, so sagte sie, „von Ausländern belästigt“. Sie fragt, ob ich vorbeikommen könne. Natürlich konnte ich. Nahm einen Schlagstock zur Hand und versichere, dass die Person dafür „bezahlen wird“. Sie beruhigt sich – und mich. Es kommt nicht dazu. Doch wieder fühlte ich mich gut.
Wie kam es dazu? Dass ich mich gut dabei fühlte, als gewalttätig angesehen zu werden? Als Täter?
Mit diesem kurzen Text möchte ich Einblicke geben, die ich recht lange aufgeschoben habe – besser formuliert: Einblicke, die ich mir nicht eingestehen wollte. Die Gründe sind vielfältig. Im Reflexionsprozess – und davor – war für mich immer wichtig, dass ich nicht gewalttätig war. Dies gab mir gewissermaßen einen Schutz, um mich von der Gewalt der NS-Szene abgrenzen zu können. Zudem hing es auch damit zusammen, dass ich mir nicht eingestehen wollte, dass ich – wie auch einige andere Aussteiger – aus einem Elternhaus stamme, das nicht ‚perfekt‘ war und dass dies meine Einstieg in die Szene begünstigt hat und mich vielleicht sogar mitunter darin gehalten hat. Diese Gründe machte ich hier im Folgenden ausführen. Als kleine Mahnung einerseits, andererseits aber auch, damit ich damit abschließen kann. Vielleicht kann ich so auch für mich selbst verständlich erklären, wie diese Situationen, die ich oben beschrieben habe, zustande kamen.
Konflikte, Schweigen, Unterstützung – meine Familie
Zunächst möchte ich hier keine Schuldabladung betreiben. Meine Eltern haben immer versucht mir alles zu geben, was ich gebraucht habe, doch wie alle Menschen sind sie nicht perfekt und wussten nicht immer, was ihr Kind brauchte. Mir hat es nie an etwas gemangelt. Gewalt gab es in meiner Familie nicht. Doch war ich gerade als junger Mann nicht sehr glücklich. Aufgrund der zahlreichen Umzüge kam es zu Brüchen innerhalb meiner Familie. In diesem Streit war ich auf der Seite meiner Mutter. Ich sah weniger die Chancen dieser Umzüge, sondern eher sah ich mich aus meiner gewohnten Umgebung herausgerissen zu werden. Einen direkten Konflikt suchte ich mit meinem Vater allerdings nicht. Somit begann ich äußerlich zu rebellieren. Ich wechselte von einer „Szene“ zur Anderen, die äußerlich jeweils immer extremer wurden. Genutzt hat mir dies wenig. In meiner Familie wurden Konflikte eher totgeschwiegen und nicht besprochen. Dies änderte sich auch nicht, als ich anfing, offen mit rechten Symbolen aufzutreten und mir im weiteren Verlauf sogar eben jene tätowieren ließ. Somit, ja, während meine Familie mich materiell immer unterstütze, sehnte ich mich nach einer emotionalen Stabilität bzw. einem Gespräch. Hinzu kam der Wunsch derjenige zu sein, der die Kontrolle hat. Derjenige, der über andere bestimmen kann und nicht über den bestimmt wird.
Mobbing und der Wunsch kein Opfer mehr zu sein
Mobbing-Erfahrungen hatte ich leider viele. Beginnend in der Kindheit, über meine Jugend, bis hin ins Erwachsenenalter. Ins Detail möchte ich nicht gehen, doch die Auswirkungen möchte ich gerne ansprechen. Der Wunsch, kein Opfer mehr zu sein, entwickelte sich bereits in der Pubertät. Ich begann ein toxisches Bild von Männlichkeit zu entwickeln und eine Faszination für Waffen und Gewalt. Dies äußerte sich zunächst an dem Gefallen von gewaltverherrlichenden Filmen und einer Sammlung von damals legalen Waffen, wie etwa Klappmesser und Schlagringe. Mit ca. 16 Jahren führte ich diese auch regelmäßig mit mir. Diese Waffen vermittelten mir Sicherheit. Einsetzen im Angriff wollte ich sie nicht, doch in meinem Kopf hätte ich sie nur in Selbstverteidigung eingesetzt. Im Zuge meines Eintritts in die rechte Szene wurde dies noch bestärkt durch den Kraftsport, den ich dann ausübte und der in der Szene entsprechend verherrlicht wurde, als auch ein Verständnis für Selbstjustiz. Was meine ich damit? Als ich in der Szene war, wurde “Ausländerkriminalität” ein Dauerthema. Auseinandersetzungen mit Personen mit Migrationshintergrund hatte ich zwar nicht, aber in der Stadt, in der ich gelebt habe, ist die Integration in einigen Stadtteilen nicht gelungen. Dies hat die Vorstellung bzw. die Rechtfertigung des eigenen Gewaltpotenzials bestärkt und meinen Wunsch nach Waffen gerechtfertigt.
Machte der Wunsch, kein Opfer mehr zu sein, mich zu einem Täter? Leider ja. Das zeigen die Beispiele vom Anfang. Durch eigene Mobbing-Erfahrungen und meine Unsicherheiten aufgrund meines Elternhauses wollte ich nicht mehr ein Opfer sein. Dieser Wunsch ist verständlich und gesund. Doch ich wollte mehr. Ich wollte auch mal der Täter sein. Das ist in der rechten Szene meiner Erfahrung nach verbreitet. Natürlich nennt man es nicht so. Wie oben bereits ausgeführt, findet man immer eine Rechtfertigung dafür. In meinem Fall war es meist der Wunsch, jemanden oder etwas zu “verteidigen”. Doch das war nicht der wahre Grund. Ich wollte es, weil es sich gut anfühlte. Ich fühlte mich mächtig und wichtig. Es ging mir eben darum, um den Wunsch, ein Täter zu sein. Denn besser fühlte sich in diesen Situationen niemand. Verhindert habe ich nichts, Integrationsprobleme wurden durch mich nicht gelöst und “sicherer” fühlte sich in meiner Gegenwart damals wohl niemand. Nun könnte man natürlich behaupten, dass es nicht “so schlimm” sei, da ich in keinem Falle zugeschlagen habe, doch in meiner Reflexion ändert das wenig. In diesen Situationen habe ich Angst verbreitet. Ich habe das Zusammenleben gestört und einigen Menschen geschadet. Zudem – und das möchte ich an dieser Stelle betonen: Es hätte an jedem dieser Abende auch schlimmer enden können. Wenn ich getrunken hatte, wurde ich oft aggressiv, ich hatte teils Waffen bei mir oder war durch Kraftsport in der Lage eine Person schwer zu verletzen. Diese Kombination mit dem hasserfüllten Gift der Musik hätte jede der oben genannten Situationen in physischer Gewalt gegenüber eines anderen Menschen enden lassen können. Ich bin dankbar, dass es nicht passiert ist.
Ich hoffe, dass dieser Text zeigt, wie sich so eine Gewaltaffinität entwickeln kann und möchte abschließen mit einer Bitte: Wenn ihr in eurem Umfeld mitbekommt, wie sich jemand optisch radikal verändert, wenn sich die Wortwahl der Person radikalisiert und, besonders, wenn die Person eine Faszination für Waffen und Gewalt entwickelt: bitte verschließt nicht die Augen davor, sondern schaut hin.
Image by Gundula Vogel from Pixabay