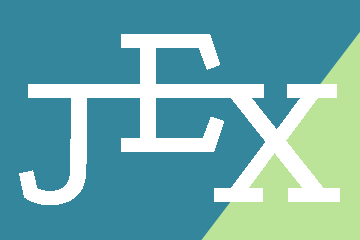(K)ein letzter Gruß – Über den Verlust ehemaliger „Kameraden“
Von Felix Benneckenstein.
Immer wieder geistern Todesnachrichten über (mehr oder weniger bekannte) Neonazis durch Fachmedien, einschlägige Foren, oder – wie etwa im Falle Siegfried Borchardt aus Dortmund – gar durch eine doch beachtliche Presselandschaft. Eigentlich logisch: wer zu Lebzeiten am lautesten auf sich aufmerksam machte, dessen Todesnachricht findet dann auch ein entsprechendes Echo. Das ist nicht nur unter Neonazis so. Dort jedoch spielen häufig auch andere Faktoren eine Rolle, insbesondere wenn es um das jeweilige Gedenken geht. Die selbsternannte Bewegung muss nach außen Stärke, Solidarität & bedingungslose Kameradschaftlichkeit demonstrieren. Politischen Gegnern und Zweiflern soll hingegen gleichermaßen klar gemacht werden, dass die entstandene Lücke geschlossen sei. Innerhalb der Szene sollen Signale an andere Gruppierungen gesendet sowie die Chance genutzt werden, mittels (teils vorgeschobener) Trauer auch rechtliche Grauzonen legal zu betreten. Auch für Ausgestiegene (und solche, die es werden wollen) werden oft die Karten durch derartige Ereignisse neu gemischt. Wie so oft, befinden sie sich zwischen sehr extremen Erwartungshaltungen. Trauer „verbietet“ sich irgendwie von selbst. „Darf“ man um Neonazis, um ehemalige „Kameradinnen und Kameraden“, trauern? Und will man das, als Ausgestiegener, überhaupt? Lässt sich das denn aktiv beeinflussen?
Da ich, als Autor dieses Artikels aufgrund meiner Biografie, in dieser Thematik nicht unbefangen bin – Ja, ich habe schon um Neonazis getrauert -, teile ich den Artikel in einen objektiven und einen subjektiv-persönlichen Teil zum Ende hin auf.
Selbstloses Gedenken an „Kamerad XY“?
Die rechtsextreme Szene selbst entscheidet über die Inszenierung der Verstorbenen. Mittels Crowdfunding wurde etwa im eingangs genannten Fall eine durchaus beachtliche Geldsumme unter dem Verwendungszweck „Beerdigung Siggi“ gesammelt. Die –teils öffentliche- Spenderliste zeigt: hier ging es offenbar bei Weitem nicht nur um „Hilfe für die Angehörigen“. Unter den unangefochtenen Top-Spendern befinden sich sogar solche, die szeneintern schon unter Verdacht standen bzw. stehen, mit dem Verfassungsschutz zusammengearbeitet zu haben oder anderweitig „Spitzel“ zu sein und, so ist zu hören, über eben jenen Verstorbenen regelmäßig äußerst abwertend gesprochen zu haben.
Todesfälle als game-changer im Ausstiegsprozess
Wie endgültig der finale Schritt des Ausstieges ist, zeigt sich unter anderem dann, wenn ehemalige Weggefährten aus dem Leben scheiden. In der Natur der Sache liegt, dass dies immer wieder vorkommt und kaum einem Ausgestiegenen verwehrt bleiben wird. Was macht dies aus Menschen, die sich aus freien Stücken dazu entschlossen haben, den Schalter von „Freund“ auf „Feind“ zu stellen?
Der Plan steht unter Umständen auf dem Kopf. Dabei sind zwei konträr verlaufende Extreme denkbar: der Ausstieg wird beflügelt. „Nun ist ja auch XY nicht mehr da…“. Manchmal werden Gruppen dadurch auch handlungsunfähig, wodurch der unmittelbare persönliche Druck abfallen kann und der Rückzug unauffälliger möglich ist. Die andere Möglichkeit jedoch ist eine eigentlich logischere: man fühlt sich der verstorbenen Person gegenüber zutiefst verpflichtet, für sie weiter zu machen. Dazu gleich mehr.
„Kamerad XY“: Unvergessen
Dass in diesem Artikel übrigens – wenig persönlich – von „XY“ gesprochen wird, ist Absicht. Tatsächlich ist der jeweilige Neonazi sehr oft ganz individuell austauschbar. Ähnlich dem Prinzip von Sekten wird dem Verstorbenen nun entsprechend seiner Außendarstellung und „Leistung für die Gemeinschaft“ gedacht. Das Ganze wirkt bei mehrmaliger Betrachtung wie ein Straßenzirkus, wie fest einstudierte Choreografien. In manchen Fällen wird besonders deutlich, dass das Ableben von eben jenem „Mitstreiter“ nur genutzt wird, um sich legal zu versammeln – oder gar, um sich ‚zu besaufen‘. Um mal wieder richtig „abzuhitlern“. Die höchste Form der Anerkennung ist dabei ein Schweigemarsch, der in diesen Kreisen schnell organisiert ist. Schwarze Kleidung samt schwarzer Fahnen – das gehört auch bei freudigen Anlässen zum Aufmarsch-Equipment, ist also immer in großer Zahl griffbereit. Nun noch ein individuelles Front-Transparent gestalten, oder einfach das vom letzten „Bomben-Gedenkmarsch“ nehmen – fertig ist die „letzte Ehre“. Bei diesen Märschen gibt es immer wieder dasselbe Bild: Ordner erinnern die „Trauergemeinde“ daran, dass sie sich bitte erst nach der Demo mit Alkohol eindecken, wie auch das Rauchen und Pöbeln unterlassen sollten. Dies gäbe ein „schlechtes Außenbild“. Muss man als Trauernde/r daran erinnert werden?
Trauerzirkus & Ideologieträger
Reflexartig wird bei jedem Todesfall innerhalb der Szene das Gedicht „Der Kamerad“ des NSDAP- Dichters Herybert Menzel ausgegraben, das mahnend daran erinnern soll: du hast nun eine besondere Verpflichtung. Du musst nun auch die Aktivitäten für „Kamerad XY“ weiterführen. Zusätzlich.
„Wenn einer von uns fallen sollt‘
der andere steht für zwei
Denn jedem Kämpfer gibt ein Gott
den Kameraden bei.“
Zitat „Der Kamerad“
Derartige Rituale sind -damals wie heute- auch deshalb wichtig, weil trotz meist christlich anmutender Symbolik bei einer solchen Bestattung die Lehre des Nationalsozialismus im Zentrum stehen muss. Dieser Ideologie nach hat der lebende Mensch schon keine andere Funktion, als „der Bewegung zu dienen“. Daher ist es nur konsequent, dass sich dies mit dem Tode nicht ändert und es kaum (bis gar keine) echte Trauer gibt.
Das Gedicht wurde übrigens durch die bekanntlich gefälschten „Hitler-Tagebücher“ zeitweise Adolf Hitler höchstpersönlich zugeschrieben. Zwischenzeitlich erhoffte man sich also, ein „Gedicht des Führers“ legal vortragen zu dürfen. Und wo wir schon beim Thema wären: schon unter Hitler wurde mit verstorbenen Nazis getrickst – deren geistige Nachfahren übernehmen die Märchen bis heute. Wie bei den angeblich „16 Blutzeugen“, die zu den Märtyrern der NS-Diktatur erklärt wurden. Noch heute spricht man in der Szene von eben jenen „16 Helden“. Dass einer davon eigentlich ein Passant war, tödlich verwundet durch einen Querschläger, ist dabei nicht so wichtig. Im zentral errichteten Ehrentempel mussten aufgrund optischer Vorlieben und symmetrischer Vereinbarkeit zweimal acht Särge öffentlich aufgebahrt werden. Auch auf Gedenktafeln las sich eine gerade Zahl vermutlich „schöner“. Der Passant selbst wird es niemandem mehr erzählen können – der Zweck heiligt dabei alle Mittel.
Lebensrunen am Straßenrand – Symbol neonazistischer Landnahme
In manchen Regionen Europas sieht man sie häufiger, in anderen überhaupt nicht: hölzerne Lebensrunen am Straßenrand, die vordergründig an einen tödlich verunfallten Menschen erinnern sollen. Auch um einen Neonazi sollen Angehörige selbstverständlich trauern dürfen.
So ist es aber doch kein Zufall, dass in sehr vielen Fällen nicht die „Todesrune“ steht. Diese wäre eine „umgedrehte Lebensrune“ und steht in der Überlieferung für den Tod, für Laien ist das in diesem Zusammenhang vergleichbar mit dem Kreuz im Christentum. Die Lebensrune hingegen steht eigentlich für die Geburt, vergleichbar mit dem Sternchen / Asterisk. Es handelt sich natürlich aber nicht um eine Verwechslung. Die Rune steht unter Rechtsextremen für das ‚Überleben‘ einer ‚weißen‘ oder ‚nordischen‘ „Rasse“. Wo immer das Symbol erscheint, soll es den Eingeweihten mitteilen: „Unsere Rasse wird siegen!“. Die Rune erinnert mitnichten an das Sterben eines liebgewonnenen Menschen, eines Verwandten, eines Kollegen, eines Freundes oder einer Freundin. Sie steht in dieser Verwendung ausschließlich als Ideologieträger des Nationalsozialismus. Dies sieht auch der Gesetzgeber so, der die Verwendung der Lebensrune in eindeutig neonazistischem Kontext als (zumindest teilweise) strafbar ansieht.
Insofern sind Lebens- oder Todesrunen am Straßenrand mitunter ein Indikator, dass in der jeweiligen Region ein ernstzunehmendes, überdurchschnittliches Problem mit einer lokalen neonazistischen Szene besteht.
„Beerdigungen werden zu politischen Versammlungen und Gegenproteste und die damit verbundene Aufmerksamkeit sind einkalkuliert. Sie sind Bestandteil der Inszenierung.“
Zweifelnde und Ausgestiegene
Plötzliche Todesfälle sorgen in organisierten Kreisen eigentlich zwangsläufig auch für personelle Rotation(en). Das kann Zweifelnde buchstäblich zurückwerfen. Etwa, wenn sie durch den Umstand plötzlich in der Hierarchie ganz oben stehen – oder, wenn sie sich dem Verstorbenen nun verpflichtet fühlen, der Druck aus der Szene auf eine emotionale Ebene transportiert wird. „Wenn XY sehen würde, wie du dich aus der Verantwortung ziehst…“ – Sätze wie dieser können wehtun, was auch der Verfasser dieser Zeilen aus eigener Erfahrung bestätigen kann. Sie können einen Druck erzeugen, dem man sich nur schwer entziehen kann.
Generell kann aber auch diese Zeit eine Chance sein, Ausstiegsgedanken können auch über genau diese Situation erst an Fahrt gewinnen. Nicht wenigen Aktivisten wird hier, ähnlich wie nach einer Inhaftierung, erst bewusst, worauf sich Solidarität und Kameradschaft eigentlich beziehen: Fehler werden auch nach dem Tod offiziell nicht verziehen. Verwandte, Bekannte und sogar Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, die vor dem Ableben eines Neonazis mit der Zugehörigkeit zur rechtsextremen Szene ein Problem hatten, werden auf keinerlei Unterstützung „hoffen“ können. Spenden werden dann in aller Regel nicht bei den Verwandten landen, sondern bei „Herzensprojekten“ des Verstorbenen – Irgendwo in der Neonaziszene also. Hier können erste Zweifel entstehen, wenn man in der Lage ist, das jeweilige Trauerspiel etwas differenzierter zu betrachten. Geht es wirklich um die Person, die verstorben ist?
Die Ideologie als mahnender Wegweiser durch die Trauer
Geht man den Weg der Ideologie noch blind und ohne jeden Zweifel, wird man alles, was dort getan wird, um einer oder einem Verstorbenen zu gedenken, als „gut“ und „absolut richtig“ bewerten. Wenig überraschend, denn das macht Fundamentalismus aus. Vom „Horst- Wessel – Lied“, der Parteihymne der NSDAP, in dem es heißt „Kameraden, die Rotfront und Reaktion erschossen / marschiern im Geist / in unsern Reihen mit“ bis zu moderneren rechtsextremen Musikstücken wird einem immer wieder in Dauerschleife eingeredet, dass „die Ahnen vom Himmel herab“ schauen. Auch dies ist kein neonazistisches Alleinstellungsmerkmal, behaftet mit der entsprechenden Ideologie sind solche Aussagen jedoch auch als eine Art Warnung zu verstehen: „Bleibe auf deinem Weg! Du bist immer unter Beobachtung! Entspreche der Erwartung!“
Der „persönliche Teil“ – Noch mehr Trauerspiel
Das engste Umfeld, die engsten Vertrauten, die Familie – diesen Menschen muss man selbstverständlich auch bei Neonazis echte Trauer zugestehen. Und das mache auch ich, der Verfasser. Etwa zehn Jahre lang war ich ein Neonazi – in dieser Zeit sind verschiedene damalige Kameraden verstorben. Die einen kannte ich besser, die anderen weniger. Meine Reaktionen waren entsprechend unterschiedlich, ich kann aus verständlichen Gründen genauer aber hauptsächlich nur auf die Fälle eingehen, die eine gewisse Öffentlichkeit erreicht haben. In einem Fall habe ich mich selbst aktiv daran beteiligt, die Trauerarbeit einer Familie massiv zu behindern. Das Thema ist für mich aus mehreren Gründen sehr emotional. Und, zugegeben: manche durch mich aufgestellten Behauptungen mögen hart klingen. Doch ich denke, dies mit meinen eigenen Erfahrungen schon hinreichend untermauern zu können.
Auch ich war ein Neonazi, der Todesfälle instrumentalisierte. Auch ich habe, wenn Szene-Größen gestorben sind, von denen ich zwischenmenschlich vielleicht nicht sonderlich viel gehalten habe, mich an allen möglichen Solidaritätsaktionen beteiligt, manchmal sogar ein Foto aufgestellt bei meinem nächsten Auftritt. Wie gesagt: Oft nur mit gespielter Betroffenheit. Man möchte sich nichts nachsagen lassen.
Auch ich musste spät – und umso bitterer, da ich es nicht mehr ändern kann – feststellen, dass ich selbst das Andenken Verstorbener missbrauchte. Für mich, für die Ideologie. Doch selten im Sinne der Verstorbenen.
Ein Lied „für“ Kevin(?)
Auf den bekannten Streamingportalen findet sich leider – denn ich habe das Werk zwar komponiert und gesungen, kann aber keine für eine Löschung erforderlichen Rechte daran nachweisen – noch heute ein ganz bestimmter Beweis dafür: Mit dem Lied „für Kevin“ wollte ich vordergründig einem jungen Mann gedenken, der am 4. 4. 2008 in NRW erstochen wurde. Wenn ich mir heute den Liedtext dazu durchlese, wird mir erst klar, wie offensichtlich ich damals gewisse Strategien verfolgte. Wenn man „den Sänger“, also mich, nicht kennt, wird man denken, dass da jemand schwer bestürzt vom Tod dieses Menschen war und viel aufzuarbeiten hatte. Doch natürlich hatte das Ganze einen anderen Hintergrund. Im Text gebe ich zu, dass ich Kevin nicht kannte. Damals habe ich mich aber nicht einmal davon überzeugt, dass eben jener Kevin es überhaupt gut gefunden hätte, wenn er zu einer Neonazi-Ikone stilisiert wird. Doch der Zweck heiligte auch hier die Mittel.
Neben einer (rückblickend selbstentlarvenden) aneinandergereihten Selbstbemitleidung musste Kevin also meiner damaligen Überzeugung nach als Gallionsfigur für eine Art „Rassenkrieg“ herhalten, denn anders kann ich die letzte Strophe heute nicht interpretieren:„Und nun liegts an uns, die leben / es darf niemals mehr passiern/ dass sie uns auf unsren Straßen massakriern“. Dieses Lied ist der offensichtlichste Teil meiner eigenen Beteiligung an diesen Mechanismen. Aber an diesem Beispiel lässt sich mehr aufzeigen: Zur damaligen Zeit gab es schon massive Konflikte innerhalb der Szene, an denen ich beteiligt war.
Erste „Verräter“- Vorwürfe wurden laut, die ich vor mir und anderen damals noch nicht eingestehen wollte. Die „Trauermarsch“-Aktionen waren für mich– leider auch relativ bewusst – auch verwendet worden, um innerhalb der Szene meine Standfestigkeit zu beweisen.
Zusätzliches Leid für die trauernden Eltern
So lieferte ich hier nicht nur die Begleitmusik zum „Gedenken“, sondern führte auch einen sogenannten Ermittlungsausschuss nach „linksradikalem Vorbild“ bei den Aufmärschen in Stolberg ein. Da es mehrmals zu Zusammenstößen mit der Polizei kam, sollte inhaftierten Neonazis schnell geholfen werden.
Dieses unglaublich sinnlose und traurige Tötungsdelikt sollte dazu herhalten, szeneinterne Konflikte zu bedienen und möglichst viel Hass in die Köpfe und auf die Strasse zu transportieren. Und ich kann mich nicht einmal damit rausreden, dass ich es nicht besser wusste: Kevins Mutter sagte 2009 in einem Bericht von „Report Mainz“: „Teilweise weiß man gar nicht, auf wen man mehr wütend ist. Auf jemanden, der dein Kind umbringt, oder auf jemanden, der Lügen verbreitet. Immer wieder dagegen ankämpfen zu müssen, dass die so über unseren Sohn reden.“
Der Ersatz für das Vorbild
Meinen Ausstieg haben einige beeinflusst – positiv, wie negativ. Der Liedermacher Michael Müller etwa war für mich eine Art musikalisches und politisches Vorbild. Obwohl – oder gerade weil? – er wohl bis zuletzt 100% Nationalsozialist war – mit allen damit verbundenen Abgründen und Unmenschlichkeiten. Als er 2009 starb, war ich eigentlich schon auf einem guten Weg des Rückzuges. Die Todesnachricht sorgte alleine schon durch die Übermittlung dafür, dass ich nochmals Kontakte in die Szene hatte. Gemeinsame Trauer kann verbinden, das steht außer Frage. In der Folge entstand eine große Lücke: Müller war einer der aktivsten Rechtsmusiker in Deutschland. Jedes Wochenende waren irgendwo Auftritte und Konzerte geplant, die nun ein „Ersatz-Programm“ brauchten. Nicht wenige davon habe ich bedient. Irgendwann wurde mir bewusst, dass ich „vom Tod Michaels profitierte“. Alleine deshalb fühlte ich mich seinem Gedenken verpflichtet. Und ich wusste, dass er keine Abstriche in seiner „Weltanschauung“ machte.
Der Selbstmord
Es sollten beinahe zwei Jahre vergehen, bis ich an dem Punkt ankam, an dem ein Ausstieg wieder möglich gewesen wäre. Dieses Mal war es jedoch ein Selbstmord im engeren Szene-Umfeld. Der Verstorbene schrieb mir wenige Tage vor der suizidalen Handlung, ob er „mal mit mir reden“ könne. Ich ließ es unbeantwortet. Ich vermutete, dass er mir nur „im Auftrag“ schreibt, unter einem Vorwand, weil man inzwischen bemerkt haben durfte, dass ich dabei war, meine Aktivitäten einzustellen. Als ich vom Selbstmord erfuhr, war ich nicht nur traurig und geschockt. Ich hätte beinahe das Ausstiegsvorhaben ein weiteres Mal komplett beiseitegeschoben. Ich fühlte mich schuldig. „Hätte ich geantwortet, würde er vielleicht noch leben?“. Ein Suizid hinterlässt diese Fragen immer. Ich werde wohl nie erfahren, worum es bei dieser Gesprächsaufsuchung ging. Dies hätte ich aber auch nicht, wenn ich Neonazi geblieben wäre. Denn mit einem vollendeten Suizid stand die Gruppe vor einem Dilemma: Aus nationalsozialistischer Sicht ist ein Selbstmord etwas höchst Feiges. Psychische Erkrankungen werden nicht ernst genommen, ein Mann mit Suizidgedanken wäre per Definition kein Mann. Doch als Mensch mit depressiven Erfahrungen wusste ich auch hier, dass diese Ideologie eine verdammt ignorante ist.
Keine weiteren Fragen.
Insofern war es auch hier eine Kontaktwiederbelebung. Die Nachricht des Todes sorgte dafür, dass ich mich ein allerletztes Mal mit meinen alten, teils jahrelangen „guten Kameraden“ traf. Doch dieses Treffen war anders. Weil mein Entschluss unabhängiger vom Agieren der Szene wurde.
Diesem letzten Treffen stimmte ich vor allem zu, weil ich wissen wollte, wie es dazu kommen konnte. Ob man, ob ich, ob irgendjemand hätte helfen können. Vielleicht wollte ich auch wissen, ob es etwas gibt, was man für die Hinterbliebenen tun kann. Die Fragen verstummten unbeantwortet. Mit Teilen der Verbliebenen gab es Konflikte weltanschaulicher Natur. Insofern stellte sich die Frage nicht. Die Frage nach dem „Warum?“ wurde nicht gestellt. Die menschlichste Aussage die ich zu diesem Freitod hörte, lautete: „Das hätte er nicht machen sollen. Man hätte ja über alles reden können“. Nein, das konnte man eben nicht. Und diese Erkenntnis ist gut, auch wenn sie schmerzt. Selbst, wenn ich noch heute manchmal daran denke, dass ich „gerne“ mal ans Grab gehen würde.
Zwischen Freund & Feind: Der Abschied
Abschied nehmen? Ein paar leise Worte loswerden? Nur, um sie mal gesagt zu haben? Vielleicht nochmal die Frage stellen, ob ich etwas hätte beeinflussen können? Den Gedanken verwerfe ich, wie immer, schnell. Nichts spricht dafür. Neben möglichen unschönen Zufallsbegegnungen am Friedhof mit alten Bekannten, sofern sie Franz* nicht sowieso schon vergessen haben, bleibt auch die Frage: Was sollte ich dort? Wäre er nicht irgendwann ausgestiegen – und dafür gibt es keine Hinweise-, würde er sicher nichts weniger wünschen, als einen Verräter an seinem Grab. Und so teile ich meine Trauer heute mit anderen Ausgestiegenen, die diese wirren Gedanken verstehen. Und bis zu diesem Artikel habe ich sie auch vor der Öffentlichkeit verschwiegen. Denn ich weiß, dass es Menschen gibt, die einen Ausstieg dann als gescheitert ansehen würden, wenn Emotionen zu früheren Weggefährten, jenseits von Hass, im Spiel sind. Als ich vom Tod „Siggis“ erfahren habe, hat mich das nicht gerade positiv gestimmt. Auch, wenn er persönlich mich schon vor meinem offiziellen Ausstieg zum „Verräter“ erklärte und damit als einer der Ersten Gewalttaten aus der Szene gegen mich legitimierte. Eins steht fest: ich bin froh, heute ein Umfeld zu haben, das versteht, dass man Gefühle und Emotionen nur sehr bedingt steuern kann.
Und nach zehn Jahren als Neonazi ist es ein Gewinn, es niemals gut zu finden, wenn Menschen sterben. Selbst, wenn es meine Feinde waren. Selbst, wenn sie mir den Tod wünschten.
Felix Benneckenstein

Felix Benneckenstein ist für EXIT-Deutschland im Rahmender „Aussteigerhilfe Bayern“ tätig, 2010 ist er aus der rechtsradikalen Szene, maßgeblich aus Kameradschaften und NPD, ausgestiegen, wo er zuvor auch als Liedermacher tätig war. Nach seinem Ausstieg begann er neben der Ausstiegsarbeit, für einige Medien und Fachmedien einzelne Artikel zu verfassen, meist mit Themenbezug Fundamentalismus / Rechtsextremismus. Heute holt er das Abitur nach, ist in der Prävention von Rechtsextremismus und in der Beratung im Bereich der Ausstiegsarbeit tätig.
Foto: Felix Benneckenstein