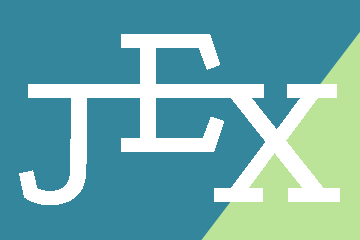Rezension: Haut, Stein
Von Miriam Steinkeller.
Für die Ausstellung Haut, Stein fotografierte Jakob Ganslmeier – in Kooperation mit EXIT-Deutschland – Tätowierungen und deren Entfernungsprozess von Personen, die aus der rechtsextremen Szene ausgestiegen sind. Im Kontrast zu Tätowierungen, die von biografischen Verläufen von AussteigerInnen erzählen, berichten Fotos von NS-Symboliken im öffentlichen Raum von einem Desinteresse sich um deren Entfernung zu bemühen.

Distanzierungsprozesse sind langfristig. Vom Aufkommen anfänglicher Zweifel, über den Entschluss mit der Szene zu brechen, bis hin zum Wunsch, dass keine Äußerlichkeiten mehr über vergangene Ansichten, Taten und Entscheidungen Auskunft geben sollen, vergehen oftmals mehrere Jahre. Jakob interviewte für die Ausstellung zwei Aussteigerinnen. Ihre Erzählungen werden auf Tonband in der Ausstellung abgespielt. Marta Tremper* erzählte von ihrem Ausstieg:
„Der Ausstieg beginnt nicht mit dem Ausstieg, sondern viel früher, wenn man irgendwann aufwacht wie aus so einem Wachkoma, es fühlt sich so an, dass sich irgendeine Synapse wieder richtig polt und du denkst: „Was mache ich hier? Warum mache ich das?“. Man stellt Fragen und setzt sich mit sich selbst auseinander. Und das passiert bestimmt zwei Jahre, bevor der Ausstieg vollzogen wird.“
Mit diesen zwei Jahren beschrieb Marta das größer und schwerer Werden ihrer Zweifel. Sie berichtete von einem Ekel, den sie zunehmend gegenüber sich und anderen aus der Szene empfunden hatte. Ausstiege sind laut Marta keine abgeschlossenen Prozesse: „Man schafft einen Ausstieg nie zu 100%“. Damit spielte sie vermutlich auf einen Selbstreflexionsprozess an, der (im besten Falle) nicht endet. Das Ich in der Gegenwart muss sich in Bezug zu Vergangenem, zu Gedanken und Handlungen setzen.
Analog zur Langfristigkeit ideologischer und lebenspraktischer Distanzierungsverläufe, können sich Tattooentfernungen gestalten. Auf den Fotos sind AussteigerInnen zu sehen, die ihre Szene-Tatoos lasern oder überstechen ließen. Lasern ist kostspielig und schmerzhaft. Selbst nach mehreren Sitzungen, bei der mittels Laserbeschuss die Farbpartikel unter der Haut zerstört und über die Leber abtransportiert werden, schimmern die Tätowierungen unter der Haut hervor.
Welches Verhältnis entwickeln AussteigerInnen zu ihrem Körper auf dem ein Hakenkreuz, „Heimat oder Tod“ oder Gesichter von NS-Täter unter die Haut eingeschrieben sind? Antonia Rollenstein* erzählt, wie sich ihre Szene-Tattoos nach ihrem Ausstieg wie eine „Vergiftung“ anfühlten. Doch trotzdem war die Entfernung nicht ihr dringendstes Vorhaben: „Ich habe den Anspruch für mich, dass es nicht nur äußerlich alles schick und schön ist, sondern auch innen drin.“ Auch wenn Tattoos von Personen, die sich distanziert haben, eindeutig auf ihre Vergangenheit verweisen, werden sie nicht unbedingt (nur) dadurch auf sie zurückgeworfen. Das „innen drinnen“ ist ohnehin immer mit dabei: Die Summe an Erfahrungen, Gewalt, die man begangen hat, sei sie physischer oder ideologischer Art, Gedanken die gedacht wurden. Auch sie schreiben sich in Körper ein.

Im Anbetracht menschenverachtender Gedanken und gewaltvoller Taten frage ich mich, was es bedeuten kann, sich ein Szene-Tattoo weglasern zu lassen. Die Befreiung von einem körperlichen „Makel“? Und damit die Möglichkeit sich wieder vor anderen zeigen zu können ohne „etwas“ zu verdecken? Ein willkommener Schmerz beim Empfinden von Reue? Antonia beschrieb für ihren Laserprozess einen erneut einsetzenden Rückblick auf ihre Szenezeit:
„Da sitzt man dann Stunden entweder beim Weglasern oder eben beim Tätowieren wieder und lässt sich das übertätowieren unter wirklich massiven Schmerzeinfluss. Da lässt man das alles nochmal Revue passieren, die Zeit – was man damit verbunden hat, wie vergiftet man war. Aber auch so die Fragestellung: „Ist es das? Ist das das Letzte, was ich über den Körper hier noch wahrnehme und abstreife? Oder bleib da noch ein Rest?“
Von Antonias „ideologischem Rest“ abgesehen, mit dem sie sich nach eigener Aussage noch jahrelang auseinandersetzen muss, blieb auch ein optischer Rest. Der Versuch ihre Szenetattoos weglasern zu lassen scheiterte, denn die Bilder blieben erkennbar. Trotz ihres ursprünglichen Entschlusses sich nicht noch einmal tätowieren zu lassen, entschied sie sich doch für ein Cover-up. Hierbei muss sich die alte Tätowierung in eine neue einfügen und ist dadurch im besten Falle nicht mehr in ihrer ursprünglichen Erscheinung erkennbar.
Altes mit Neuem in Bezug zu setzen ist auch eine sinnvolle Praxis für öffentliche Orte. Jakob fotografierte Architektur, die durch nationalsozialistische Symbolik besetzt ist. Eine nicht unbekannte Burg in Österreich, auf der ein riesiges Hakenkreuz ragt, eine Häuserfassade mit SS- Ruinen und ein Reichsadler über einer Fußgängerpassage als Beispiele. Wo genau sich diese Orte befinden, ist unklar. Sie erhalten keine Beschreibung in der Ausstellung, denn die in Bezug stehenden Personen und Institutionen haben sich gegen eine Zuordenbarkeit entschieden.
Dekonstruktion statt verschwinden lassen ermöglicht einen Bezug zur Vergangenheit zu finden, der Reflexion zulässt. Sinnvolle Praxis meint Zeugnis- und Lernorte einzurichten, ohne „Reglorifizierung“ zu ermöglichen: Weder dürfen Orte „verschwinden“, sodass sie rechtsextreme Gruppen wiederentdecken und zu Pilgerstätten machen können, noch ist es zulässig NS-Symbolik ohne Kommentar stehen zu lassen. Das Hakenkreuz auf der Burgruine Hochkraig in Kärnten wurde nach Fertigstellung der Ausstellung übermalt und zu einem Fensterkreuz umgestaltet, 74 Jahre nach dem Ende des Nationalsozialismus.
*Die Namen der Aussteigerinnen wurden geändert.
Podcast zur Ausstellung
Die Interviews zur Ausstellung wurden für einen Podcast eingesprochen. Die Geschichten von fünf Männern und zwei Frauen erzählen von ihrem Ein- und Ausstieg: über Gründe, Zweifel, von der Entscheidung bis zum Bruch, von ihrem Leben nach dem Ausstieg und der Entfernung von Szenetattoos. Während die Ausstellung die Entfernung der Tattoos fotografisch dokumentiert, wird durch die Geschichte die Person hinter den Fotografien sichtbar.
Die Geschichten wurden von Felix Lobrecht, Patrick Salmen, Julia Gamez Martin, Steffen Schroeder, Felix Römer, Ariana Baborie und Kai Lüftner eingesprochen.

Foto: Fabian Wichmann